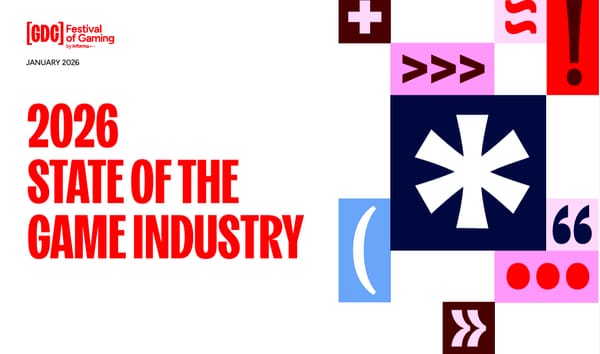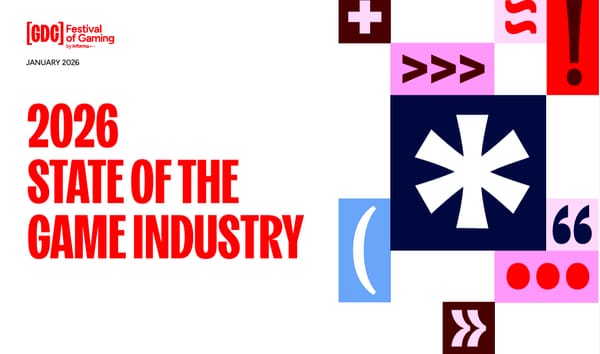KJM-Gutachten kritisiert manipulative Designs vieler Games




Ein Gutachten im Auftrag der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) kommt zu dem Schluss, dass bei beliebten Spielen manipulative Spieldesigns eingesetzt werden, welche die Gefahr einer Computerspielsucht erhöhen. Risikomindernde Elemente seien die Ausnahme. Die KJM plädiert für technische Alterskontrollen und lobt die USK.
Es ist ein 80-Seiten starker Bericht, der es - zumindest Stellenweise - in sich hat: Die KJM hat jetzt das von ihr beauftragte Gutachten "Förderung von exzessivem Nutzungsverhalten bei Games" vorgelegt. Und die Ergebnisse sind nicht gerade schmeichelnd für die Gamesbranche, wie der KJM-Vorsitzende Dr. Marc Jan Eumann zusammenfasst: „Das Ergebnis ist – leider – eindeutig: Viele populäre Spiele nutzen die Unerfahrenheit von Kindern und Jugendlichen aus. Fair Play sieht anders aus", so Eumann. Und er schiebt eine zentrale Forderung hinterher: "Schutz beginnt bei einer wirksamen technischen Alterskontrolle!"
Für das Gutachten wurden die Inhalte von insgesamt zehn Spielen analysiert, die ganz bewusst ausgewählt wurden, weil sie entweder laut der JIM-Studie bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt sind, oder weil bei ihnen Nutzung problematischer Mechanismen bekannt sei. Konkret wurden unter die Lupe genommen: "Minecraft" (1.19.4), "FIFA 23", "Fortnite", "Clash of Clans", "World of WarCraft", "League of Legends", "Toca Life World", "Pokémon Go", "Modern Ops: Gun Shooting Games" und "Barbie Dreamhouse Adventures".
In der Analyse wurden Punkte wie die allgemeine Beschreibung, der Installationsprozess, Merkmale des Spielemechanismus, die exzessives Gaming begünstigen können (Digital Nudges und Dark Patterns), und risikomindernde Aspekte untersucht. Dabei wurden - wenig überraschen - in allen untersuchten Spielen Digital Nudges und Dark Patterns in unterschiedlicher Ausprägung gefunden. Als problematisch betrachtet das Gutachten, dass zugleich wenige bis kaum risikomindernde Aspekte wie Einwilligungen der Eltern, Informationen zur verbrachten Spielzeit oder den ausgegebenen finanziellen Mittel oder Mitel zur Selbstbegrenzung gefunden wurden.
"Teils entsteht der Eindruck, dass Spieleanbieter:innen durch komplizierte Elternmenüs und -informationen erzieherische Spielebeschränkungen mutwillig nicht unterstützen. Das macht es für Eltern und Erziehende sehr mühsam", kritisiert Prof. Dr. Rudolf Kammerl, Autor der Studie, die Publisher. Er fordert klar erkennbare Hinweise.
Und nicht nur Hinweise. Die Studie selbst zeigt Maßnahmen auf, welche die Risiken für problematische Nutzungsweisen senken könnten. Neben der Transparenz problematischer Inhalte und Mechaniken geht es vor allem um Spielzeitbeschränkungen, Limits und Kinderschutz bei In-Game-Käufen und Lootboxen und ganz generell eine Förderung eines gesunden und medienkompetenten Spielverhaltens.
An anderer Stelle weisen auch die Autor:innen des Gutachtens darauf hin, "dass im öffentlichen Diskurs das Risiko einer computerspielbezogenen Verhaltensstörung oftmals überbetont" werde. Gleichwohl stellen sie fest, dass bei der Dynamik der Entwicklung auch Interventionen notwendig seien."Eine differenzierte und unideologische Debatte über Risiken und Potenziale von Onlinegames ist daher umso bedeutender", heißt es im Gutachte.
Und auch die KJM ist in ihrer Pressemitteilung zur Studie nicht pauschal im Kritikmodus, sondern weist darauf hin, dass die USK beispielsweise bereits neue Prüfregeln erarbeitet hat und umsetzt, die Nutzungsrisiken in Form von Dark Patterns berücksichtigen: "Es ist gut, dass sich die USK dessen annimmt. Das Gutachten zeigt, wie viel zu tun ist. Die vorgenommenen Änderungen müssen sich nun in der Praxis beweisen. Allerdings bleibt die grundsätzlich fehlende technische Alterskontrolle eine Schwachstelle", so Eumann.