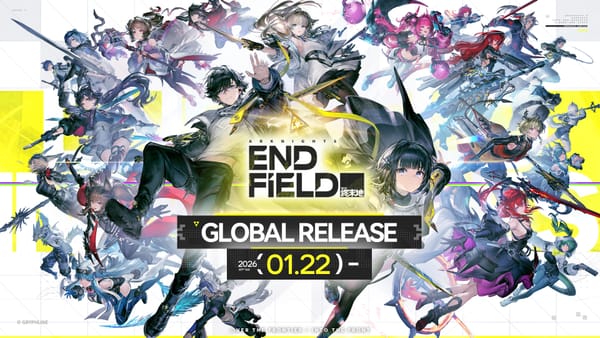Malte Behrmann: "Sie müssen sie nicht erziehen, sondern fördern!"




Während der Auftaktveranstaltung "Games in Rheinland-Pfalz" an der Hochschule Trier hielt Prof. Dr. Malte Behrmann (bbw Hochschule Berlin und Leiter des GAME-Arbeitskreises Förderung) auf Einladung der Game Up!-Initiatoren den viel beachteten Vortrag "Medienförderung in Deutschland und international", den wir an dieser Stelle dokumentieren.
Ich bin gebeten worden, einen Vortrag zu halten zu dem Thema "Medienförderung in Deutschland und international". Ein großes Thema, mit dem ich mich seit knapp 20 Jahren beschäftige. Ich tue dies als Forscher, Linda (Breitlauch, Anm. d. Red.) weiß das genau, aber auch als politischer Aktivist. Deswegen ist es ungefähr so, wie wenn man einen Atomphysiker, der 20 Jahre lang versucht hat, an der Kernfusion zu arbeiten, fragt, wie funktioniert Physik. Ich kann dazu sehr viel sagen, aber das würde den Rahmen meines halbstündigen Vortrags sprengen. Ich kann mich aber auch bemühen, nur sehr wenig zu sagen, auf neudeutsch "in a nutshell". Deswegen möchte ich meine Überlegungen hier auf einige sehr wenige, grundsätzliche Anmerkungen beschränken.
Zu allererst müssen wir die Frage klären, warum die Produktion und Herstellung von Medienprodukten überhaupt durch den Staat gefördert werden soll. Man könnte sich ja auch auf den Standpunkt stellen, dass Medien - ähnlich wie alle andern Güter - durch den Markt entstehen und der Markt letztlich auch ihre Entstehung regulieren sollte. Eine Förderung wäre dann nicht erforderlich. Ich möchte zunächst erklären, warum diese Annahme leider in die Irre geht.
Im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Walter Benjamin) sind Medien Kultur- und Wirtschaftsgüter zugleich. Ökonomisch haben Medienprodukte hohe Fixkosten, aber kaum Reproduktionskosten. Die Herstellung eines Films oder eines Computerspiels ist teuer. Aber die Herstellung selbst ist im Grunde genauso teuer, ob man nur einen Konsumenten hat oder viele Millionen. Es gibt zwar manchmal noch Vervielfältigungskosten, und natürlich sind da Vertriebskosten, aber es verhält sich anders als bei anderen industriellen Produkten, sagen wir mal Lebensmittel, wo stets variable Kosten pro Stück anfallen. Im Zeitalter der Digitalisierung potenziert sich dieses Phänomen noch einmal. Daher ist der break-even point anders gelagert. Das trägt dazu bei, dass besonders erfolgreiche Produkte besonders hohe Margen haben; in nicht wenigen Fällen ist der Gewinn allein dann deutlich höher als die Herstellungskosten. Ein Beispiel aus dem Kino: "Das Leben der Anderen" spielte bei etwa 4 Millionen Euro Produktionskosten allein als Box Office 77,4 Millionen US-Dollar ein, also fast das 20-fache (damit war diese Ausnahmeproduktion mit Oscar wesentlich rentabler als viele Hollywood- Produktionen). Auch bei Games: In guten Jahren nahm ein Spiel wie "WOW" allein in Europa deutlich über eine Milliarde ein - auch wenn die Herstellung teuer war, hat sie dennoch nur einen Bruchteil pro Jahr gekostet.
Das ist zunächst eine gute Nachricht, und man könnte denken, hier sollte man aufhören; immerhin ist es ja auch vielen nicht entgangen, dass sowohl der Gamesmarkt als auch der Filmmarkt milliardenschwer sind. Warum sollte man also gerade hier Steuergelder ausgeben? Aber es gibt eben auch die Kehrseite der Medaille. Dieses "hit driven business" kennt eben auch viel mehr Verlierer als Gewinner.
Das "the winner takes it all"-Phänomen
Schauen wir uns die aktuelle Situation bei Mobile Games an: Etwa die Hälfte des weltweiten Umsatzes wird von den Top 25 Spielen generiert. Die weniger erfolgreichen Projekte geraten sehr schnell unter Druck, denn auch hier sind die Fixkosten hoch und nicht immer amortisiert. Und dies geschieht häufig völlig unabhängig davon, ob die Projekte qualitativ hochwertig bzw. wertig sind. Häufig liegen die Erfolgsfaktoren völlig außerhalb des Einflusses der Entwickler und haben mit Plattformen oder inhaltlichen Trends zu tun. Man spricht vom "the winner takes it all"-Phänomen.
Daneben steht die Tatsache, dass Medienprodukte Vertrauensgüter sind. Wir als Käufer können sie eigentlich nicht vorher testen, wir kaufen in der Regel eine Katze im Sack. Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass die Hersteller in der Regel eben auch nicht wissen, ob ihre Produktion tatsächlich so erfolgreich werden wird. Selbst sehr erfahrene Vertriebsexperten wissen es letztendlich nicht und können sich nur auf ihren Instinkt verlassen.
Diese Phänomene führen dazu, dass die Herstellung von Medien-Produkten immer besonders riskant ist und bei den meisten Produkten der break-even point kaum erreicht wird, während zugleich die besonders erfolgreichen Projekte durch die Decke gehen. Es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass diese Beobachtungen vor allem eines bewirken - große Heimatmärkte werden begünstigt. Denn wenn ich wie China oder die USA einen großen homogenen Heimatmarkt habe, dann kann ich diesen Risiken eine Portfolio-Strategie entgegenstellen, bei der ich einige riskantere mit erfolgversprechenden Projekten bündele. Das bedeutet aber auch, dass die Importware aus USA oder China - oder im Filmbereich Indien - weniger damit zu tun hat, dass die Qualität, die in diesen Ländern gemacht wird, besser ist, sondern dass wegen der Größe des Heimatsmarktes die Risikostruktur besser ist.
Das ganze wird nun noch verstärkt durch sogenannte Netzwerk-Effekte und zwar zunächst ökonomisch, also z.B. sind alle bei Facebook, weil alle bei Facebook sind, und das führt dazu, dass alle bei Facebook sind (bitte jetzt nicht schreien "Facebook nimmt rapide ab", das weiß ich auch - ich versuche, hier nur ein Phänomen zu erklären). Es gibt also auch inhaltliche Netzwerk-Effekte, so gehen z.B. alle in den James Bond Film oder laden sich das neue "Angry Birds 2"-Spiel herunter, weil die Marke bereits so groß ist. Im Kinobereich - wo diese Überlegungen erstmals entwickelt wurden - spricht man vom Blockbuster-Effekt. Auch sind die Projekte in der Regel bereits am Heimatmarkt amortisiert, bevor sie hier ankommen und mit unseren neuen Produktionen konkurrieren.
Das heißt "in a nutshell" Größe führt zu mehr Größe, und das verstärkt sich selbst. Während man solche Dinge auch in der normalen Industrie beobachten kann, geht es in der Medienindustrie insoweit ungemein schneller und radikaler zu. Diese Mechanik ist bei Computerspielen und Kinofilmen sehr ähnlich zu beobachten. Die Risiken für den einzelnen Hersteller sind enorm, bei Computerspielen wohl noch größer, weil Technologie vorgehalten werden muss. Und darum brauchen wir Förderung; sie ist letztlich eine Verbesserung der Risikostruktur, um kleine und mittelgroße Heimatmärkte in der Medienproduktion wettbewerbsfähig zu halten.
Janusköpfigkeit der Medien als Kultur- und Wirtschaftsgut
Man könnte sich jetzt auf den Standpunkt stellen, dass es am sinnvollsten wäre, eine weltweite Konzentration der Produktion z.B. in Kalifornien umzusetzen. Aber es handelt sich eben zugleich auch um kulturelle Produkte. Es ist eben wichtig, dass wir unsere eigenen Medienprodukte haben, weil wir damit auch unsere Kultur medial reproduzieren, auch wenn wir es nicht merken. Deshalb müssen wir darauf achten, dass unser Heimatmarktanteil eine relevante Größe darstellt, z.B. 40 Prozent. Wir können hier die so genannte Janusköpfigkeit der Medien als Kultur- und Wirtschaftsgut nur unterstreichen.
Erst in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde hier das Kino als Kulturgut anerkannt. Bei Computerspielen ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Zwar hat der Bundestag bereits 2009 beschlossen Computerspiele als Kulturgut anzuerkennen, aber diese Entschließung gerät gelegentlich in Vergessenheit. Bei der Bevölkerung selbst ist die Ansicht wahrscheinlich noch nicht so verbreitet, leider. Dabei gibt es große Parallelen: Bei beiden Medienprodukten ist der Einfluss auf unsere Denkweise, unsere Strukturen, unsere Kommunikationsfähigkeit und unser Realitätsverständnis nicht zu unterschätzen. Filme wie Computerspiele werden heute als Teil unserer Realität wahrgenommen und prägen unsere Denkstrukturen und unser Bewusstsein. Genau deswegen sind sie kulturell. Und deswegen ist es nicht egal, ob wir Medien aus unserem eigenen kulturellen Umfeld haben oder nicht. Denn mit diesen Medien reproduzieren wir unsere kulturelle Situation und manifestieren sie im digitalen Zeitalter.
Förderung führt in einem bedeutsamen Schlüsselbereich zu Wachstum
Dabei sei darauf hingewiesen, dass die Förderung selbst auch zu Wachstum führt, und zwar in einem aus vieler Hinsicht bedeutsamen Schlüsselbereich. Eine starke Film- und Computerspielindustrie hat große Auswirkungen auf die kulturelle Selbstbehauptung in der Demokratie, sie hat starke technologische Implikationen, deren Bedeutung noch wächst und sie schafft hochwertige und spannende Arbeitsplätze. Insofern ist der kulturelle Anteil immer auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten.
Meine zweite Bemerkung: Auf der Basis dieser Erkenntnis - mit einigen Variationen - haben wir in fast allen Bereichen der Medienwirtschaft Regulierung, die Vielfalt erzeugen soll. Wenn wir uns mit dem Buch befassen, so stellen wir fest, dass wir eine so genannte Buchpreisbindung in Deutschland haben. Diese wurde auch seitens Deutschland gegenüber der EU-Kommission mit Zähnen und Klauen verteidigt. Die Buchpreisbindung begünstigt vor allen kleine Verlage und kleine Auflagen, denn sie verbietet den Mengenrabatt für den Bestseller. Im Pressebereich leisten wir uns ein so genanntes Presse-Grosso-System, was entgegen der Marktstrukturen Vielfalt im Angebot sichert.
"Die Unterscheidung zwischen Informations- und Unterhaltungsmedien ist eine Farce"
Wir tun dies nicht nur aus kulturellen Gründen, sondern auch aus demokratietheoretischen Gründen. Die Vielfalt der Meinungen ist gerade auch im politischen Diskurs wichtig. Dabei wissen wir von Habermas (Jürgen Habermans zählt zu den weltweit meistrezipierten Philosophen und Soziologen der Gegenwart, Anm.d. Red.), dass die wahlentscheidenden Wechselwähler häufig keine harten politischen Informationen konsumieren, sondern vor allem unterhaltende Medien wahrnehmen, die dann die Wahlentscheidung auslösen. Insofern ist die Unterscheidung zwischen Informationsmedien und Unterhaltungsmedien eine Farce. Im engeren audiovisuellen Bereich legen wir heute einen Rundfunkbeitrag auf alle Haushalte um und finanzieren damit öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen. Im Kinobereich werden die Produktion mit Förderungen unterstützt, die einerseits über eine Filmabgabe erhoben werden und andererseits auch aus Staatsmitteln kommen. Die Förderung wird von Bund und Ländern geleistet und umfasst ungefähr 300 Millionen Euro pro Jahr.
Und bei Computerspielen? Auch Computerspiele sind letztlich ein audiovisuelles Medium. Es soll zwar Leute geben, die behaupten, Games seien gar keine audiovisuellen Medien und würden nicht unter die sogenannte Audiovisuelle Medienrichtlinie fallen - das war schon immer Unsinn, heute jedoch noch mehr denn je. Aber das ist ein anderes Thema. Im Computerspielbereich gibt es in Deutschland vereinzelte Länder-Förderungen im Bereich von einigen 100.000 Euro und einen Deutschen Computerspielpreis, der auch bei weitem nicht das Budget von 1 Million Euro erreicht. Den Kritikern von Computerspielen halte ich in diesem Zusammenhang vor, dass Computerspiele in Deutschland in der Produktion kaum unterstützt werden. Andere Medienproduktionen allerdings schon, und zwar eben nicht nur die Filmproduktion, sondern auch das Fernsehen und über andere Mechanismen auch andere Medien. Dass es bei Games eine andere Vorstellung von Vielfalt gibt, hängt auch mit dem Finanzierungsmöglichkeiten zusammen. Wenn wir - wie auch in anderen Medien - mehr alternative Finanzierungsmöglichkeiten hätten, hätten wir auch mehr Vielfalt.
Die Illusion vom freien Markt
Meine dritte und letzte Bemerkung bezieht sich auf den internationalen Markt: Es ist eine Illusion, zu glauben, die Produktion von Computerspielen oder die Produktion von Filmen sei dem freien Markt überlassen. In beiden Bereichen ist der Einfluss staatlicher Förderung heute sehr hoch. Tatsache ist aber, dass hochsubventionierte Titel mit heimischen Titeln, die ohne Förderung auskommen mussten, am Markt sehr wohl konkurrieren müssen. Das liegt auch daran, dass die Risiken eben auch in anderen Ländern besonders hoch sind, dort der Staat aber eher bereit ist, diese mitzutragen. Förderung ist eben vor allem auch Risikobeteiligung, vor allem an den besonders riskanten ersten Schritten eines Projektes. Lassen Sie mich jetzt nur kurz beschreiben, was so auf der Welt in Bezug auf Games-Entwicklungsförderung passiert.
Wir gehen davon aus, dass zum Beispiel in Kanada, dem Land mit bis zu 50 Prozent Lohnkostenzuschuss, große Produktionskapazitäten aufgebaut worden sind. Auch in den Vereinigten Staaten gibt es - anders als man denkt -großzügige Programme auf state-level. Und zwar z.B. in Staaten wie Texas, Florida oder Georgia, die nun nicht unbedingt für besonders linke Politik bekannt sind. In Lateinamerika fördern Brasilien, Argentinien und Mexiko; eine genauere Untersuchung wäre hier natürlich sinnvoll.
Auch in Asien gibt es großzügig Förderung für die Entwicklung von Computerspielen und Filmen, so z.B. in Singapur, China, Japan, Südkorea, Taiwan, Malaysia. Aber auch in Australien und Neuseeland gibt es Förderprogramme. Selbst im Iran gibt es eine große Stiftung, die Computerspiel-Entwicklung fördert, und zwar auf der Basis einer Umlagefinanzierung.
"Nur in Deutschland gibt es keine großen nationalen Förderprogramme"
Innerhalb Europa kennen wir Förderprogramme in fast allen Mitgliedsstaaten. Für Games gibt es in den Nordischen Staaten Förderprogramme. Neben dem Nordic Game Programm (das gerade ausgelaufen ist) existieren insbesondere in Finnland, Dänemark und Norwegen große Fördertöpfe. In Frankreich gibt es seit vielen Jahren Förderung, in Großbritannien hat es jetzt die Tory-Regierung auch eingeführt. Daneben gibt es Programme für die Games-Entwicklung in Spanien, zum Teil in Italien, in Österreich, in Belgien, der Schweiz und in den Niederlanden. Nur in Deutschland gibt es keine großen nationalen Förderprogramme, sondern nur vereinzelte Länderförderungen. Und diese kommen häufig sehr schüchtern daher und haben gerade auch unter Jugendschutzgesichtspunkten arge Bedenken zum Beispiel in Baden-Württemberg.
Und da muss ich wieder fragen: und dann wundert man sich? Man wundert sich, dass Deutschland mit über 2,5 Milliarden Euro Marktvolumen nur einen Heimatmarktanteil von unter 10 Prozent hat (zu meiner Zeit war das mal 40 Prozent). Ungläubig schüttelt man hierzulande in der Politik den Kopf, wenn man die Zahlen des finnischen Verbandes vorträgt, der darlegte, dass die 8 Millionen Förderung jährlich für die finnische Gamesbranche dem Staat Jahr für Jahr das 16-fache an Steuermitteln einbringt. Nun ist Finnland heute im Bereich Mobile Gaming weltführend und drei der wichtigsten Games Apps kommen aus diesem kleinen Land. Trotzdem brauchte Rovio 52 gescheiterte geförderte Projekte, bis mit "Angry Birds" der erste Durchbruch kam - deutlich mehr als eine Milliarde Downloads. Auch hat Finnland nur 5,4 Millionen Einwohner. D.h. wir haben ungefähr 1,4 Euro Förderung für die Games-Entwicklung pro Einwohner pro Jahr in Finnland. Bei uns in Deutschland wären das 118 Millionen Euro.
Was ergibt sich daraus: Die weit verbreitete Vorstellung, im Games- und Kinobereich wird es der private Markt schon richten, ist eine ideologische Vorstellung. Sie ist einfach falsch, der Markt wird sich eigene Bahnen suchen, und dann wird es eben kaum noch Produktionen vor Ort geben. Es genügt nicht, auf die Größe des Computerspielemarktes zu verweisen, es kommt darauf an, was auch bei den Herstellern vor Ort ankommt. Diese Form von Marktideologie ist etwa so verblendet, wie die der überzeugten Kommunisten, die es jedenfalls zu meinen Studienzeiten noch an den Universitäten gab: Die Welt ist in Wirklichkeit viel komplizierter.
Und sicherlich ist auch der Bereich der öffentlichen Subventionen nicht immer heilsbringend. Thomas Jarzombek, der CDU MdB, der sich mit diesen Fragen seitens der Politik viel beschäftigt hat, sagt immer so schön, dass er bezweifle, dass, wenn sich der Staat in so etwas einmischen würde, etwas Sinnvolles herauskommen würde. Insoweit ist sicherlich auch Vorsicht geboten. Gerade in meiner Zeit als General Secretary der European Game Developer Federation habe ich in Abgründe der Förderpolitik auf EU-Ebene geblickt, die jede Vorstellungskraft übersteigen. Deswegen müssen wir das klug anstellen.
"Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts"
Trotzdem: Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Wir müssen in Deutschland endlich ein Fördersystem an den Start bringen, dass seinen Namen verdient. Wenn Rheinland-Pfalz heute schon einen Beitrag leisten möchte, dann bin ich gerne bereit mitzuhelfen. Aber machen Sie nicht den Fehler und geben das ganze Geld für Coaching aus oder Infrastruktur oder Serious Games. Geben Sie es den Studios und lassen Sie die machen. Lassen Sie sie Games machen und keine Visualisierungstechnologien für Meerentsalzungsanlagen. Haben sie keine Angst davor, einem jungen Team auch mal selbst Geld in die Hand zu geben. Nur dann können sie erfolgreich sein und letztlich auch Steuern zahlen. Sie müssen sie nicht erziehen, sie müssen sie fördern.
Prof. Dr. Malte Behrmann
DER AUTOR: Prof. Dr. Malte Behrmann ist Rechtsanwalt und Professor an der bbw Hochschule in Berlin, wo er den Master-Studiengang "Management of Creative Industries" verantwortet. Zuvor war Behrmann Generalsekretär des EGDF (European Games Developer Federation), und noch früher beim GAME Bundesverband.