"Runes of Magic" - eine kritische Würdigung des BGH-Urteils



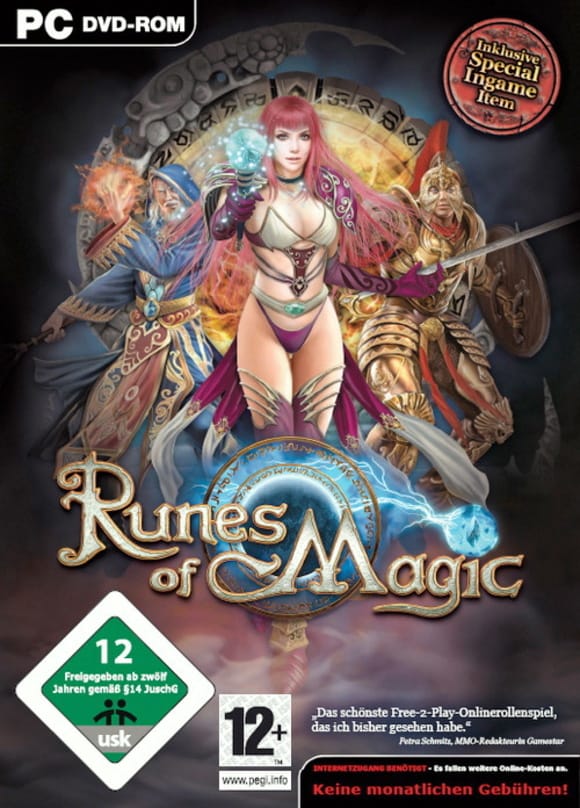
Mitte letzten Jahres hat der BGH mit seinem "Runes of Magic"-Urteil in der Gamesbranche für einigen Wirbel gesorgt. Nun haben die Richter (fast als "Weihnachtsgeschenk") die vollständige Urteilsbegründung (Az. I ZR 34/12) geliefert. Für GamesMarkt haben Konstantin Ewald und Felix Hilgert von Osborne Clarke die Begründung des BGH einer kritischen Würdigung unterzogen, die auch bis auf Weiteres geltende Praxishinweise umfasst.
Im Sommer hatte der Bundesgerichtshof sein Urteil zur Werbung für virtuelle Items in einem Onlinespiel verkündet. In einem Forum hatte der Spielbetreiber mit der Formulierung "Pimp deinen Charakter-Woche [?] Diese Woche hast Du erneut die Chance Deinen Charakter aufzumotzen! Schnapp Dir die günstige Gelegenheit und verpasse Deiner Rüstung & Waffen das gewisse 'Etwas'!" geworben, verbunden mit einem Link auf die Shopseite, auf der Items erworben werden konnten.
Nachdem die Vorinstanzen eine Klage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen auf Unterlassung dieser Aussage abgewiesen hatten, hat das höchste deutsche Zivilgericht die Werbung überraschend untersagt, weil sie unmittelbare Kaufaufforderungen an Kinder enthalte, was durch eine EU-Richtlinie und das deutsche Wettbewerbsrecht (UWG) verboten ist.
Nun liegt die vollständige Urteilsbegründung vor (und kann auf der Website www.spielerecht.de nachgelesen werden). Sie ist allerdings teilweise in sich widersprüchlich und überzeugt nicht völlig. Das Urteil ist aber(ausnahmsweise) noch nicht rechtskräftig. Gameforge hat Einspruch eingelegt, so dass der BGH über den Fall nun erneut entscheiden muss. Die weitere Entwicklung in dieser Sache bleibt damit abzuwarten.
Auslegung des Begriffs "Kind"
Der BGH stellt zu nächst fest, dass sich die angegriffene Werbung an Kinder richte. Was ein "Kind" ist, wird in der Richtlinie nicht definiert; die Ausführungen des Gerichts zur Auslegung dieses Begriffs sind kritikwürdig. Im deutschen Recht ist ein "Kind" nur eine Person unter 14 Jahren. Fraglich ist, ob in der Richtlinie damit auch ältere Minderjährige (nach deutscher Terminologie: "Jugendliche") gemeint sind. Das Gericht lässt die Frage offen, weil sich die Werbung angeblich "allgemein" an Minderjährige richte. Dies wird mit der Anrede in der 2. Person Singular begründet, ohne auf die Altersgrenze von 14 Jahren näher einzugehen. Mehrfach heißt es, die Erwägungen gelten gerade auch für Kinder unter 14, doch wirkt dies fast wie ein Nachgedanke und wird nicht näher begründet.
Insgesamt klingen die Ausführungen des Gerichts zum Adressatenkreis der Werbung nur dann schlüssig, wenn man den Begriff "Kind" in der Richtlinie so auffasst, dass alle Minderjährigen gemeint sind. Etliche Formulierungen im Urteil deuten aber darauf hin, dass der BGH den Begriff "Kind" eher im "deutschen" Sinn verstehen möchte, etwa der Verweis auf die "im Schwerpunkt eindeutig an Jugendliche gerichtete Werbung, von der auch das eine oder andere Kind unter 14 Jahren angesprochen wird".
Es entsteht der Eindruck, dass es dem BGH in diesem konkreten Fall ins Konzept gepasst hätte, alle Minderjährigen als "Kinder" zu betrachten, er sich aber nicht in allgemeinen Worten festlegen wollte, weil er erstens eigentlich auch die Interpretation von "Kind" als Personen unter 14 Jahren für richtiger hält und zweitens bei einer entscheidungserheblichen Frage über die korrekte Auslegung des EU-Rechts gar nicht selbst hätte entscheiden dürfen, sondern die Frage dem EuGH vorlegen müssen.
Adressatenkreis der Werbung
Zur Begründung, warum sich die Werbung an Kinder richte, verweist das Gericht auf die Anrede in der 2. Person Singular sowie auf angeblich "kindertypische" Sprache und die Verwendung von Anglizismen.
Diese Begründung ist in sich widersprüchlich. Zum Einen wird - zutreffend - ausdrücklich festgehalten, dass die "werbliche Ansprache ? mit 'Du'" auch bei Werbung für Erwachsene nicht mehr unüblich ist. Sodann heißt es aber, bei der gebotenen Beurteilung der Werbung im Gesamtzusammenhang reiche die "direkte Ansprache in der zweiten Person Singular" in Verbindung mit "kindertypischen Begrifflichkeiten einschließlich gebräuchlicher Anglizismen", um doch eine gezielte Ansprache von Kindern zu bejahen. Welcher Unterschied zwischen der "Anrede mit 'Du'" und der "Ansprache in der zweiten Person Singular" bestehen soll, ist aus der Begründung leider nicht ersichtlich.
Die einzigen Anglizismen in der Werbeanzeige sind die Begriffe "pimp"/pimpen und "Dungeon". Nur auf diese Worte kann sich der BGH folglich mit dem Anglizismen-Argument stützen. Diese Begriffe dürften aber gerade Kindern (im Gegensatz zu Jugendlichen) eher weniger geläufig sein. Insbesondere ist "pimp" ursprünglich ein umgangssprachlicher Ausdruck für einen Zuhälter und damit kaum ein "kindertypischer" Begriff.
Klärungsbedürftig, und wohl zu bejahen, wäre hier also die Frage, ob es sich bei den Formulierungen der Werbeaussage nicht vielmehr um eine weniger formelle "internettypische" Sprache handelt, die an den Sprachgewohnheiten solcher Jugendlicher und Erwachsener ausgerichtet ist, die üblicherweise MMOs spielen. Das liegt für einen Begriff wie "Dungeon" (wörtlich "Verlies") aufgrund der Spielthematik besonders nahe.
Zu weit geht es in jedem Fall, aus der bloßen Verwendung von Anglizismen auf einen Ausrichtung auf Kinder zu schließen, da Anglizismen in der Werbung, und zwar auch in eindeutig nur an Erwachsene gerichteten Werbeaussagen, allgegenwärtig sind. Auch für die Kombination aus der zweiten Person Singular und einigen wenigen Anglizismen kann nichts anderes gelten. Weder für sich genommen noch gemeinsam führen diese Merkmale zu einer Ausrichtung gerade auf Kinder.
Es bleibt als Begründung, warum die Werbeaussage angeblich an Kinder gerichtet sein soll, allein der reichlich diffuse, nicht weiter begründete oder durch Beispiele belegte Verweis auf eine angeblich "kindertypische" Sprache. Welche Formulierungen genau angeblich "kindertypisch" sind und warum diese Begrifflichkeiten gerade Kinder (also Minderjährige unter 14 Jahren) ansprechen, verrät der BGH in der Begründung ebenfalls nicht.
Die Thematiken sowohl der Anglizismen als auch der "kindertypischen" Begriffen werfen allerdings Tatsachenfragen auf, die der BGH als Revisionsinstanz gar nicht entscheiden kann. Wenn es nach seiner Rechtsauffassung auf die Klärung einer bestimmten Tatsache ankommt, die die Vorinstanzen nicht für erheblich gehalten haben, muss er den Streit zur Klärung dieser Frage an die Instanzgerichte zurückverweisen.
Mittelbare vs. unmittelbare Kaufaufforderung
Schließlich liege auch eine unmittelbare Kaufaufforderung vor. Dass der BGH in diesem Zusammenhang die Formulierung "Schnapp Dir?" mit dem als Kaufaufforderung anerkannten "Hol Dir?" gleichsetzt, überrascht nicht und dürfte im Ergebnis keinen Rechtsfehler darstellen. Weniger gelungen sind aber die Ausführungen zur Abgrenzung von mittelbarer und unmittelbarer Kaufaufforderung. Das Gericht sieht die Werbeaussage und das verlinkte Shopangebot als Einheit, so dass der erforderliche Produktbezug hergestellt wird; auch sei das Betätigen eines Links kein erheblicher Zwischenschritt, der einer Aufforderung die Unmittelbarkeit nehmen könnte. Der Rechtsverkehr im Online-Bereich sei daran gewöhnt, sich weitere Informationen (wie etwa das Impressum oder nähere Angaben zu Preisen und Versandkosten) durch das Klicken auf Links zu erschließen.
Diese Auffassung ist aber deshalb kritikwürdig, weil sie im Ergebnis zu einem unangemessen weiten Verbot führt. Bei konsequenter Fortführung dieser Rechtsprechung wäre dann schon jede Imagewerbung eines Unternehmens unzulässig, wenn sie erstens auch Kinder anspricht und zweitens einen Link auf eine Website des Unternehmens enthält, auf der auch konkrete Produkte angeboten werden.
Für die Auslegung des Begriffs der "Unmittelbarkeit" hätte es zudem nahe gelegen, einmal die englischen und französischen Sprachfassungen der Richtlinie zu konsultieren, die nämlich nicht nur mit der Abgrenzung "mittelbar/unmittelbar" arbeiten, sondern als verbotenes Verhalten nur eine besonders intensive Aufforderung ansehen ("exhortation" / "inciter"). Auch in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Vorlagepflicht zum EuGH.
Zu weiter Tenor
Extrem problematisch ist schließlich die Weite des Urteilstenors: Zu unterlassen ist danach die Aufforderung "Schnapp Dir die günstige Gelegenheit und verpasse Deiner Rüstung & Waffen das gewisse 'Etwas'" - ohne Verweis auf den Link auf die Shopseite und ohne Verweis auf die verwendeten Anglizismen, die ja beide in der Begründung tragende Rollen spielen. Diesen Tenor trägt die Begründung schlichtweg nicht.
Fazit und Praxishinweise
Die Urteilsbegründung wirft viele Fragen auf und lässt den Leser in mancher Hinsicht ratlos zurück. Soll jede Werbung mit Anglizismen und Links auf Shopseiten nun verboten sein? Das ginge deutlich zu weit - und Rechtssicherheit sieht auch anders aus. Es hat den Anschein, als habe der BGH diesen Fall unbedingt selbst - also ohne Vorlage an den EuGH und ohne Zurückverweisung an die Instanzgerichte - entscheiden wollen. Da es sich um ein Versäumnisurteil handelt, ist die Entscheidung aber noch nicht rechtskräftig. Der Spielebetreiber hat Einspruch eingelegt; nunmehr muss sich der BGH erneut mit dem Fall befassen. Da der Vorsitzende Richter des entscheidenden ersten Senats in Kürze in den Ruhestand gehen wird, wird auch die personelle Besetzung des Gerichts bei der endgültigen Entscheidung eine andere sein. Richtigerweise müsste die Unterlassungsklage der Verbraucherzentrale abgewiesen werden.
Bis auf Weiteres gelten aber folgende Praxishinweise:
Nutzungsbedingungen sollten unbedingt an deutsches Recht angepasst oder jedenfalls aktuell überprüft werden. Das Übersetzen universell gültiger AGB ist keine Lösung.
Wenn Nutzungsbedingungen ein Mindestalter für die Spielteilnahme vorsehen, lässt sich argumentieren, dass Werbung für Ingame-Items jedenfalls nicht an Personen unterhalb dieser Altersgrenze gerichtet ist.
Werbeaussagen im Spiel und begleitend zum Spiel sowie die Einbindung der Werbung als solche sollten geprüft und im Zweifelsfall vorsichtiger (indirekter) formuliert werden.
Wo für den BGH die Grenze zwischen einer "kindertypischen" und einer unproblematischen "erwachseneren" Wortwahl liegt, kann kaum abstrakt bestimmt werden. Vorsicht ist daher auch bei der Verwendung informeller Formulierungen geboten.
DIE AUTOREN
Osborne Clarke
Konstantin Ewald
Tel: +49 221 5108 4160
E-Mail: konstantin.ewald@osborneclarke.com
Osborne Clarke
Felix Hilgert LL.M.
Tel: +49 221 5108 4160
E-Mail: felix.hilgert@osborneclarke.de